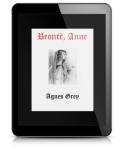 Agnes Grey, das Debüt von Anne Brontë, erweist sich als leise, aber eindringliche Stimme im Kanon der viktorianischen Literatur. Der Ich-Erzähler – die junge Agnes – schildert mit nüchterner Klarheit die Zumutungen ihres Lebens als Gouvernante in zwei vornehmen Haushalten, die sie mit Idealismus angetreten hatte.
Die familiäre Notlage zwingt Agnes, ihre verschuldeten Eltern zu unterstützen, und so verlässt sie ihr behütetes Elternhaus, um eine Anstellung anzutreten – zunächst im Haus der Bloomfields, später bei den Murrays. In beiden Haushalten bleibt ihr Handlungsspielraum minimal: Die Kinder sind eigenwillig, die Eltern misstrauisch oder gleichgültig, und Agnes findet sich in der paradoxen Position wieder, weder zu den Dienern noch zu den Herrschaften zu gehören.
Brontës Stil ist zurückgenommen, fast asketisch: Statt dramatischer Zuspitzungen setzt sie auf stille Beobachtung, subtile Ironie und moralische Überzeugung. Agnes wird nicht zur heroischen Frau mit großem Eifer, sondern zur Geduldigen, die ihrem Gewissen treu bleibt – nicht ohne innere Kämpfe und selbstkritische Reflexion.
Dennoch zeigt sich im Verlauf des Romans Hoffnung: In Begegnungen mit aufrichtigen Menschen – etwa mit dem Pfarrgehilfen Edward Weston – und im festen Willen Agnes’, verantwortungsvoll zu handeln, wächst ein zartes Glücksversprechen. Am Ende findet sie Trost und Lebenssinn in einer respektvollen Verbindung.
Kritisch betrachtet wirkt Agnes’ Resignation – ihre stille Duldsamkeit gegenüber ungerechtem Verhalten – mitunter provozierend; moderne Leser*innen mögen sich wünschen, sie würde öfter klare Grenzen ziehen. Doch gerade in dieser Zurückhaltung liegt die eigentliche Subversion des Romans: Brontë zeigt, wie eine Frau in einer patriarchalischen Welt, ohne laute Rebellion, ihre Würde bewahrt.
In seiner Schlichtheit und seinem ethischen Kern ist Agnes Grey ein stiller, aber bis heute berührender Klassiker – ein Spiegel weiblicher stillen Stärke im 19. Jahrhundert.
Editor: Hans-Jürgen Horn |
 Anne Brontë (1820–1849)
Anne Brontë (1820–1849)
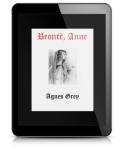
 Anne Brontë
Anne Brontë
 Deutsch
Deutsch
 13.05.2019
13.05.2019 828.4 KB
828.4 KB 165
165 3.741
3.741