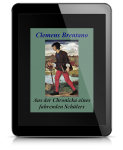 In „Chronika eines fahrenden Schülers“ entfaltet Clemens Brentano das Bild eines zarten Wanderers, der – arm an Besitz, reich an Seele – durch die Welt zieht und mit ruhiger Stimme von seiner Sehnsucht erzählt. Der junge Johannes, geboren 1358, verkörpert den fahrenden Schüler, der auf Reisen zu sich selbst findet, zugleich als Schreiber im Haus des Ritters Veltlin eine Zuflucht und zugleich Prüfstein erlebt.
Brentanos Text bewegt sich auf schmalem Grat zwischen spätmittelalterlicher Rahmenerzählung und romantischer Sentimentalität: Er lässt Erzählungen in den Erzählungen aufscheinen – von Mutterliebe, von verführerischen Meeresgeistern, vom bitteren Brunnen und vom Perlengeist. Diese Zwischenwelten sind oft dunkel, oft märchenhaft, nie narzisstisch überzogen – sie spiegeln vielmehr eine existenzielle Suche nach Harmonie und Sinn.
Stilistisch besticht der Text durch seine schlichte, manchmal fast naiv wirkende Sprache: Brentano bezeichnet sein Werk selbst „einfältig“ und bittet um Nachsicht bei Kritikern, die „Eisenfresserei und Isländisches Moos“ gewohnt sind. Diese Selbstmarkierung ist kein falsches Understatement: Gerade in der Unmittelbarkeit dringt der Erzähler in das Sehnsuchtszentrum des Lesers.
Die Eingliederung des Gedichts „Der Spinnerin Nachtlied“ unterstreicht thematisch die Verbindung von Liebe und Melancholie – die klagende Stimme, die Spinnfäden, das Erinnern.
Als literarisches Juwel der Frühromantik lädt die „Chronika“ dazu ein, mit Johannes zu wandern – nicht nur durch Landschaften und Städte, sondern durch Abgründe des Herzens und Höhen des Glaubens. Wer sich von dieser „einfachen Geschichte“ berühren lässt, dem offenbart Brentano eine zarte Welt, in der die Armut des Körpers mit Überfülle des Inneren einhergeht. |
 Clemens Brentano (1778 – 1842)
Clemens Brentano (1778 – 1842)
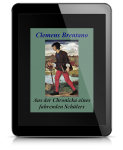
 Clemens Brentano
Clemens Brentano
 Deutsch
Deutsch
 08.11.2013
08.11.2013 562.86 KB
562.86 KB 71
71 6.428
6.428