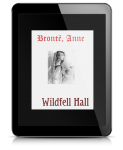 Die Herrin von Wildfell Hall (Originaltitel The Tenant of Wildfell Hall, 1848) von Anne Brontë ist ein kraftvolles und scharfzüngiges Porträt häuslicher Gewalt, weiblicher Selbstbehauptung und moralischer Konventionen — und gleichzeitig ein frühes Beispiel feministischer Literatur.
In einem Rahmengerüst aus Briefen erzählt Gilbert Markham, wie die rätselhafte Helen Graham mit ihrem kleinen Sohn in das verlassene Herrenhaus Wildfell Hall zieht und bald Gegenstand von Klatsch und Verdächtigungen wird. Allmählich enthüllt sich ihre Vergangenheit: Helen war verheiratet mit dem charmanten, aber moralisch verfaulten Arthur Huntingdon, einem Trinker und Fremdgänger. Aus Liebe und Pflichtversprechen hatte sie gehofft, ihn zu bessern — doch nach Jahren psychischer und körperlicher Erniedrigung flieht sie schließlich, um sich und ihren Sohn zu schützen.
Brontës Stil hier weicht deutlich von jenem ihrer Schwestern ab: statt romantischer Erhebung liegt das Gewicht auf schonungsloser Realität, detaillierten Beschreibungen und inneren Konflikten. Die Welt, die sie entwirft, ist nicht mystisch oder düster – Wildfell Hall ist verfallen, feucht, düster, kein Geisterhaus, sondern ein Symbol überkommener patriarchaler Macht.
Das Besondere liegt in Helens unsentimentaler Standhaftigkeit: Sie weigert sich, stillzuhalten, und wählt den Weg der Flucht statt erzwungener Passivität. In einer Zeit, da Frauen praktisch keine Rechte besaßen, ist Helens Entscheidung, sich Autonomie zu erkämpfen, radikal – man könnte sagen, dass sie die Tür zur feministischen Literatur aufstößt.
Natürlich ist der Roman nicht ohne Schwächen: Die Doppelstruktur mit Gilbert-Erzählung und Helens Tagebuch wirkt streckenweise ungleich, und manch Dialog erscheint der moralischen Botschaft geopfert. Dennoch überstrahlt die dramatische Kraft, mit der Brontë Themen wie Ehe, Alkoholismus, weibliche Identität und soziale Moral verhandelt, all das. Viele heutige Leser sehen in Wildfell Hall nicht nur ein literarisches Meisterwerk, sondern einen mutigen Ausdruck eines sich formierenden feministischen Bewusstseins.
Übersetzer: W. E. Drugulin, 1850
Editor: Hans-Jürgen Horn |
 Anne Brontë (1820–1849)
Anne Brontë (1820–1849)
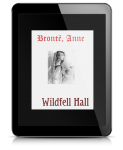
 Anne Bronte
Anne Bronte
 Deutsch
Deutsch
 07.10.2019
07.10.2019 2.5 MB
2.5 MB 589
589 3.162
3.162